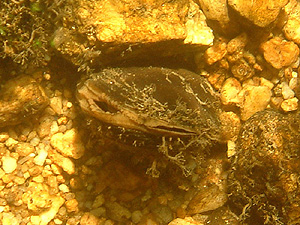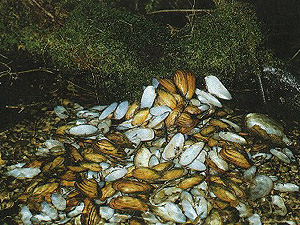Die Gefährdung der Süßwassermuscheln |
Inhalt
Einleitung
 Zum Seitenanfang.
Zum Seitenanfang.
| |

Naturbelassene Bäche sind Heimat für zahlreiche einzigartige
Arten, manchmal sogar für Muscheln. Bild: Klaus Bogon. |
Süßwassermuscheln sind ein ausgezeichneter Indikator für die Wassergüte der
Gewässer, die sie bewohnen. Da sie sich durch Filterung ihres Atemwassers
ernähren, spielen sie einerseits eine bedeutende Rolle bei der Gesunderhaltung
ihres Gewässers. Andererseits gehören sie aber auch zu den ersten Lebewesen, die
von der Wasserverschmutzung in Mitleidenschaft gezogen werden. Durch ihre
filternde Ernährungsweise kommen Muscheln in Kontakt mit großen Mengen von
Wasser und neigen daher dazu, Schadstoffe, die im Wasser enthalten sind, im
Gewebe anzusammeln.
Neben der unmittelbaren Einflussnahme des Menschen auf das Leben der Muscheln
gibt es auch Faktoren, die indirekte Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von
Süßwassermuscheln haben.
Menschlicher Einfluss
 Zum Seitenanfang.
Zum Seitenanfang.
Perlenfischerei
Die europäische Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) produziert
Perlen, die sich in ihrer Qualität mit Perlen von Salzwasserperlmuscheln, wie
Pinctada und Ostrea (Austern) messen können. Die Flussperlmuschel, die im
Besonderen in den Oberläufen von sauerstoffreichen und kalkarmen Bächen und
kleinen Flüssen vorkommt, ist schon früh in der menschlichen Geschichte als
Perlenlieferant genutzt worden. Jedoch benötigen Flussperlmuscheln 10 Jahre, um
geschlechtsreif zu werden und nur eine von 2700 Flussperlmuscheln enthält
wirklich eine Perle. Aus diesem Grund wurde die Perlenfischerei schon früh zu
einem Vorrecht des Adels erklärt und besonders ausgebildete Perlenfischer wurden
dazu angestellt, die Perlen zu ernten, ohne den Muscheln dabei unnötigen Schaden
zuzufügen.
| |

Flussperlmuschelbänke, wie hier in Schweden, sind in Europa
heute sehr selten. Bild:
Joel Berglund.
|
Perlenwilderer jedoch kümmerten sich nicht um den Schaden, den sie unter den
Muscheln anrichteten. Trotz drakonischer Strafen konnte der Perlenwilderei kein
Einhalt geboten werden; selbst heute noch, da Flussperlmuscheln wegen ihrer
Seltenheit unter strengem Naturschutz stehen, stellt sie ein Problem dar.
Der Schaden, den die Perlenfischerei unter der Flussperlmuscheln angerichtet
hat, muss als so ernst angesehen werden, dass die Flussperlmuscheln in einem
Großteil ihres ursprünglichen Verbreitungsgebietes in Mitteleuropa inzwischen als
ausgestorben gelten.
Erholungsgebiete in Gewässerlandschaften
 Zum Seitenanfang.
Zum Seitenanfang.
Gewässerlandschaften stellen für den Menschen oftmals auch einen wertvollen
Erholungsraum dar. Stille Gewässer, aber auch Fließgewässer, wie Flüsse, werden
für Erholung und Sport genutzt. Darunter zählen z. B. Segeln, Boots- und
Floßfahrten, sowie natürlich Schwimmen. Die Auswirkungen auf die Gewässergebiete
sind ebenso schädlich und vielfältig, wie sie für den Menschen als wichtig
erachtet werden müssen. Zum einen werden Muschelpopulationen mechanisch zerstört, zum
anderen selbst bedrohte und geschützte Arten zum Spaß gesammelt. Die
gesetzwidrige Entsorgung von Abfällen in Gewässergebieten stellt nur eine
weitere Beeinträchtigung der Natur dar.
Veränderung von Flussgebieten durch bauliche
Maßnahmen

Veränderung eines Bachlaufs durch eine bauliche Maßnahme.
Quelle: LFU Bayern. |
|
Damit Flüsse durch den Menschen als Transportweg genutzt werden können, ist
es oftmals notwendig, ihre Gestalt durch bauliche Veränderungen zu wandeln. Dazu
gehören die Ausbaggerung des Flussbetts, die eine Nutzung mit größeren und
tiefer gehenden Wasserfahrzeugen ermöglicht, die Flussbegradigung, sowie die
Verstärkung der Flussuferböschungen. Alle drei Maßnahmen beeinträchtigen das
natürliche Leben in einem Fluss erheblich: Das Ausbaggern eines Flusslaufs
zerstört vorhandene Muschelpopulationen vollständig auf mechanischem Wege. Die
bauliche Verstärkung durch Betonieren des Flussufer macht es den Muscheln
unmöglich, sich einzugraben. Charakteristische Lebensgemeinschaften des
Flussufers werden ebenfalls zerstört. Die Begradigung von Flussläufen hat neben
der mechanischen Zerstörung von Muschelpopulationen eine Zunahme der
Fließgeschwindigkeit zur Folge, die ebenfalls die Lebensbedingungen an langsam
fließendes Wasser gewöhnter Muscheln verschlechtert. Zusätzlich verändert sich
die Zusammensetzung des Fischbestandes im Gewässer. Auch dies hat weit reichende
Auswirkungen auf das Leben von Muscheln, die zu ihrer Entwicklung meist
bestimmte Fischarten (s. u.) benötigen.
Abnahme der Wasserqualität
 Zum Seitenanfang.
Zum Seitenanfang.
Abwässer und Industrieabfälle
Die Einleitung von Abwässern und Industrieabfällen in unsere Gewässer ist
eine der schlimmsten Umweltsünden, derer sich der Mensch schuldig macht. Die
Liste ihrer negativen Auswirkungen ist endlos, dabei zieht man noch nicht in
Betracht, dass der Mensch eben dieses Wasser auch selbst konsumiert. Aufgrund
ihrer filternden Ernährung neigen Muscheln, wie einleitend bereits erwähnt,
dazu, Giftstoffe in ihrem Organismus anzureichern. Aus diesem Grund sind sie
natürlich auch besonders anfällig für deren schädliche Auswirkungen. Eine
mögliche Auswirkung bestimmter Giftstoffe ist zum Beispiel die Sterilisierung
ganzer Muschelpopulationen.
Eutrophierung durch Überdüngung

Verschlammung eines Bachlaufes. Quelle: LFU Bayern. |
|
Düngung erreicht höhere Erträge und dadurch höhere Profite. Diese ebenso
einfache wie kurzsichtige Rechnung hat zur absoluten Überdüngung agrarischer
Nutzflächen geführt. Durch Niederschläge werden Düngemittel ins Grundwasser,
sowie in die Gewässer ausgeschwemmt. Die Einschwemmung von Nitraten (Düngemittel
enthalten große Anteile von Nitraten und anderen Mineralsalzen) führt zu einer
starken Zunahme des Algenwachstums im Gewässer. Nach ihrem Absterben zerfallen
die Algen, führen so zu einer starken Zunahme des Schlammgehaltes und zu einer
Abnahme des Sauerstoffgehaltes im Gewässer, mit entsprechenden negativen
Auswirkungen für Fische, Muscheln und andere Wasserbewohner.
 Eutrophierung.
Eutrophierung.
Übersäuerung
 Zum Seitenanfang.
Zum Seitenanfang.
| |

Bisamratte (Ondathra zibethicus) (Bild: Leonard
Lee Rue). |
| |
|
| |
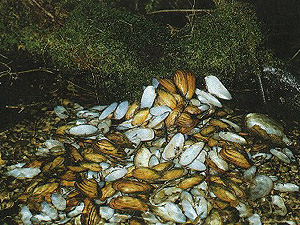
Fraßplatz einer Bisamratte: LFU Bayern. |
Die Luftverschmutzung durch Abgase von Kraftfahrzeugen und Industrie führt
zum gewissen Grad zum Phänomen des sauren Regens, indem sich die Gase, vor allem
Stick- und Schwefeloxide, mit dem Regenwasser zu Säure verbinden. Neben den
weitreichenden negativen Auswirkungen auf die Bewohner des trockenen Landes
führt der saure Regen auch zu sinkenden pH-Werten im Wasser, was Muscheln ebenso
beeinträchtigt, wie Fische und andere Wasserbewohner. Muscheln im Besonderen
erleiden eine graduelle Zerstörung ihrer Kalkschale - ein Phänomen, das auch bei
Landschnecken zu beobachten ist. Zusätzlich leidet der Genitalapparat, so dass
es zu einer chemisch induzierten Unfruchtbarkeit ganzer Populationen kommt.
Jedoch nicht nur der saure Regen führt zur Übersäuerung des Wassers. Auch die
übermäßige Pflanzung von Fichten durch den Menschen aus wirtschaftlichen Gründen
führt zu einer Versauerung des Bodens, der durch den Regen ins Wasser geschwemmt
wird.
Biotische Faktoren
Eingeführte Fressfeinde
Der Mensch ist natürlich bei weitem nicht das einzige Lebewesen, das sich von
Muscheln ernährt. Die Bisamratte (Ondathra zibethicus, Bild rechts) wurde als Pelzlieferant
aus Nordamerika nach Europa eingeführt. Wenn die Vegetation ausreicht, ist die
Bisamratte vor allem Pflanzenfresser, aber gerade, wenn im Winter die
Nahrungsversorgung knapp wird, ernährt sich die Bisamratte zum wachsenden Anteil
von Muscheln. Bisamratten können an ihren Fraßplätzen Haufen von mehreren
Tausend Muscheln pro Winter anhäufen.
Veränderung in der Faunenzusammensetzung
 Zum Seitenanfang.
Zum Seitenanfang.
Die Einführung fremder Arten hat zu unvorhersehbaren Auswirkungen auf die
heimische Faune geführt. Bereits erwähnt wurden die Auswirkungen der Ansiedlung
der Bisamratte, zu erwähnen sind aber auch die absichtliche Einführung der Regenbogenforelle (Oncorhynchus
mykiss) und die unabsichtliche Einschleppung der
Zebramuschel (Dreissena polymorpha), sowie
der verwandten Quagga-Muschel (Dreissena bugensis).
Die Regenbogenforelle wurde als
Nutzfisch eingeführt, um die viel kleinere heimische Bachforelle (Salmo trutta
fario) zu ersetzen. Die Flussperlmuschel jedoch hängt entscheidend von der
Bachforelle oder dem Lachs (Salmo salar) als Wirtsfisch für ihr parasitisches Larvenstadium, die
Glochidien,
ab. Die Verdrängung der Bachforelle durch die Regenbogenforelle hat hingegen zur
Folge, dass Flussperlmuschelpopulationen sich nicht mehr vermehren können, überaltern
und schließlich aussterben.
Im Gegensatz zur Regenbogenforelle wurden die Dreikantmuscheln (Dreissenidae)
im Ballastwasser von Schiffen und an Bootsrümpfen hängend eingeschleppt. Die
Zebramuschel hat sich jedoch auch von selbst, allerdings unter Nutzung des
Flussnetzes und der menschlichen Schiffereiverbindungen, weiter ausgebreitet. Im
Gegensatz zur Flussperlmuschel und ihren
Verwandten entwickelt sich die
Zebramuschel nämlich durch planktonische Larven, die bis zu acht Tage durch die
Wasserströmung verbreitet werden.
Nicht nur verstopft sie zum Ärgernis des Menschen
Wasserleitungen und andere Wasser-Infrastruktur durch ihre Kolonien, sondern sie überwächst auch
andere Muscheln und Krebse und schädigt sie, z.B. durch Nahrungskonkurrenz. Unter anderem erzeugt sie z.B. durch
ihre filtrierende Ernährung Sediment, das unter ihr sitzende Muscheln langsam
erstickt. Ihre erst seit den 1980er Jahren in Deutschland und seit den späten
90er Jahren in Österreich aufgetretene Verwandte, die
Quagga-Muschel (Dreissena bugensis)
hat in der Donau und angrenzenden Flüssen, sowie einigen Seen Oberösterreichs
ähnliche Auswirkungen.
Quasi als ausgleichende Gerechtigkeit führt die zunehmende Besiedlung
heimischer Gewässer durch Dreikantmuscheln oftmals auch zur Verletzung von
Badegästen aufgrund der scharfkantigen Schalen dieser Muschelarten.
 Zum Seitenanfang.
Zum Seitenanfang.
Letzte Änderung:
11.08.2025 (Robert
Nordsieck).