| This page in English! |
Schließmundschnecken (Clausiliidae) Teil IClausiliidae J. E. Gray, 1855 |
| Schließmundschnecken (Clausiliidae) Teil I | Schließmundschnecken (Clausiliidae) Teil II | Schließmundschnecken (Clausiliidae) Teil III |
|---|---|---|
|
|
|
 Ruthenica filograna: Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankreich. Bild: Gaëtan Jouvenez (iNaturalist). |
 Micropontica caucasica: Harz, Sachsen-Anhalt, Deutschland Bild: Tuber (iNaturalist). |
||
 Nenia tridens: Canóvanas, Puerto Rico. Bild: Scott Bolick (iNaturalist). |
 Tauphaedusa tau: Sakyo Ward, Kyoto, Japan. Bild: Thomas Hernandez (iNaturalist). |
![]() Hartmut Nordsieck
auf hnords.de: Umfassende
Seite zum Thema Clausiliidae: Allgemeine Informationen, Rezente Clausiliidae,
Fossile Clausiliidae, Veröffentlichungen.
Hartmut Nordsieck
auf hnords.de: Umfassende
Seite zum Thema Clausiliidae: Allgemeine Informationen, Rezente Clausiliidae,
Fossile Clausiliidae, Veröffentlichungen.
 Alopia lischkeana cybaea: Zărnești, Brașov, Rumänien Bild: Phil Benstead (iNaturalist). |
Dennoch sind die meisten Schließmundschnecken kleiner als 20 mm, nur die größte einheimische Schließmundschneckenart, die Bauchige Schließmundschnecke (Macrogastra ventricosa), erreicht 19 mm Gehäusehöhe. Im Gegensatz dazu wird die Kleine Schließmundschnecke (Clausilia rugosa parvula), ihrem Namen gerecht: Die kleinste einheimische Schließmundschnecke erreicht nur 9,5 mm Gehäusehöhe.
Die größte aller Schließmundschnecken ist aber keine einheimische Schneckenart, sondern sie kommt in Japan vor: Megalophaedusa martensi (Bild rechts) wird über 40 mm groß!
 Neniatlanta pauli (Clausiliidae, Laminiferinae): Pyrénées Atlan- tiques, Aquitaine, Frankreich. Bild: Maëlan Adam (iNaturalist). |
 Megalophaedusa martensi aus Shizuoka, Japan. Bild: Takahashi, Wikipedia. |
![]() Quelle:
MolluscaBase eds. (2025):
Clausiliidae J. E. Gray, 1855.
Quelle:
MolluscaBase eds. (2025):
Clausiliidae J. E. Gray, 1855.
![]() Schließmundschnecken (Clausiliidae):
Systematische Liste (Kurzversion).
Schließmundschnecken (Clausiliidae):
Systematische Liste (Kurzversion).
![]() Komplette Artenliste der
Schließmundschnecken (Clausiliidae) für Österreich laut
CLECOM.
Komplette Artenliste der
Schließmundschnecken (Clausiliidae) für Österreich laut
CLECOM.
 Gitterstreifige Schließmundschnecke (Clausilia dubia). Bild: Martina Eleveld. |
![]() Schileyko, A. A. (2000): "Treatise on recent
terrestrial pulmonate molluscs". Part 5. Clausiliidae. - Ruthenica Suppl. 2 (5):
565 - 729.
Schileyko, A. A. (2000): "Treatise on recent
terrestrial pulmonate molluscs". Part 5. Clausiliidae. - Ruthenica Suppl. 2 (5):
565 - 729.
 Balea perversa: Chateu de Dave, Namur, Belgien. Bild: Gilles San Martin (iNaturalist). |
![]() Wolfgang Weitlaner: "Geheimnis
der fliegenden Schnecke geklärt"
(Innovationsreport.de, 27. 01. 2006).
Wolfgang Weitlaner: "Geheimnis
der fliegenden Schnecke geklärt"
(Innovationsreport.de, 27. 01. 2006).
Neben ihrer charakteristischen Schalenform unterscheiden sich die einheimischen Schließmundschneckenarten von den meisten übrigen Schnecken außerdem dadurch, dass ihr Gehäuse im Allgemeinen links anstatt rechts gewunden ist. In einigen Gruppen der Clausiliidae gibt es aber auch rechts gewundene Arten, etwa bei den Alopiinae. Zu diesen gehören sowohl die in den Karpaten heimische Gattung Alopia, als auch die im südlichen Balkangebiet heimische Gattung Albinaria, die beide rechts gewundene Arten aufweisen.
Schließmundschnecken leben von Algen, die sie mit der Radula abraspeln. Wie andere Landlungenschnecken sind sie Zwitter, es gibt allerdings manche Schließmundschneckenarten, die, wie die einheimische Gemeine Schließmundschnecke (Alinda biplicata), ovovivipar sind, d.h. die Eiablage wird so lange verzögert, bis die Jungen im Körper des Muttertiers geschlüpft sind und dann lebendig zur Welt kommen können. Auch besteht die Möglichkeit, dass Eier mit weit entwickelten Embryonen abgelegt werden.
Ihr charakteristisches Gehäuse verschafft den Schließmundschnecken einen entscheidenden Evolutionsvorteil: Sie können sich bei Trockenheit in den kleinsten Ritzen im Gestein oder in der Baumrinde verstecken. Besonders kommt dieser Vorteil dort zum Tragen, wo der Verbreitungsschwerpunkt der Schließmundschnecken liegt: Obwohl die Familie paläarktisch verbreitet ist, kommen weitaus die meisten Arten auf der Balkanhalbinsel, vor allem in Griechenland, vor, überdies auch in Kleinasien und im Kaukasus-Gebirge.
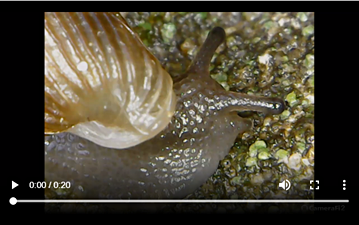 Gemeine Schließmundschnecke (Alinda biplicata) beim Algenweiden auf ei- nem Stein. Filme: Martina Eleveld. |
|
"Die Gemeine Schließmundschnecke ist noch recht häufig,
einige andere Arten der Familie sind bei uns sehr selten und im Bestand bedroht.
Als Spaltenbewohner besiedeln diese Tiere einige sehr gefährdete Biotope, wie
alte Mauern, isolierte Felsen und Totholz. Auch im Garten können wir diesen
interessanten kleinen Schnecken Lebensraum und Schutz bieten, wenn wir nicht
jede Ritze der alten Gartenmauern neu vermörteln oder in schattigen Gartenecken
einige Steine oder etwas altes Holz liegen lassen. Neben den
Schließmundschnecken werden viele andere Tierarten diese Verstecke nutzen und
den Garten ökologisch wertvoller machen." Quelle: |
 Gemeine Schließmundschnecke (Alinda biplica- ta): Bergh, Gelderland, Niederlande. Bild: Walter Wimmer (iNaturalist). |
 Papillifera papillaris: Hérault, Languedoc-Roussillon, Frank- reich. Bild: Philippe Geniez (iNaturalist). |
Neben Form und
Skulptur des Gehäuses kann auch die Form der Schalenmündung zur Bestimmung
herangezogen werden: Man unterscheidet runde, ovale und sogar birnenförmige
Mündungen. Außerdem kann zur Bestimmung der häufigsten heimischen
Schließmundschneckenart, der Gemeinen Schließmundschnecke (Alinda biplicata)
auch die Nackenansicht des Gehäuses (die von der Mündung abgewandte Seite)
herangezogen werden, die eine charakteristische Nackenfurche aufweist (![]() Bild in neuem Fenster
anzeigen!).
Bild in neuem Fenster
anzeigen!).
Grundsätzlich werden alle Schneckengehäuse bei einem Vergleich in der Mündungsansicht mit nach oben zeigender Gehäusespitze betrachtet. Nur so können die folgenden Unterscheidungsmerkmale auch wirklich eindeutig ermittelt werden:
 Schließapparat (Clausiliar) der Gemeinen Schließ- mundschnecke (Alinda biplicata). Bild: Jiří Novák, biolib.cz. |
Nach ihrer Lage unterscheidet man dabei drei Haupttypen von Falten: Die Gaumen- oder Palatalfalten befinden sich an der Außenseite der Mündungswindung. Gegenüber davon, auf der Spindelseite der Mündungswindung befindet sich die untere oder Columellarfalte. Darüber, am oberen Rand der Mündungswindung, befindet sich die obere oder Parietalfalte. Unterhalb der Columellarfalte kann sich eine weitere Falte, die Subcolumellarfalte, befinden.
Diese Falten (auf der parietal-columellaren (rechts oben) Seite auch als Lamellen bezeichnet) sind Bestandteile des Clausiliars, eines innerhalb der Schnecken einzigartigen Schließapparates, der dieser Schneckengruppe ihren ungewöhnlichen Namen Schließmundschnecken eingetragen hat. Den genaueren Aufbau dieses Schließapparates erkennt man jedoch nur, wenn man mit Hilfe einer Pinzette die äußere Wand der Mündungswindung öffnet und unter dem Binokular betrachtet.
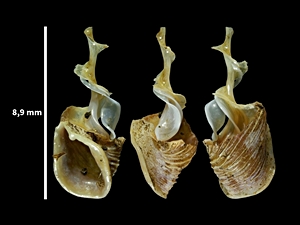 Endwindungen von Alinda biplicata, geöffnet. Sichtbar sind die Schalenspindel (Columella) und das Clausilium. Bild: Mathijs Zonneveld (iNaturalist). |
Bei den meisten Schließmundschneckenarten findet man dann eine löffelförmige Kalkplatte, deren elastischer Stiel an der Schalenspindel (Columella) ansetzt. Dieses so genannte Clausilium wird an die Wand des Gehäuses gedrückt, wenn sich die Schnecke ausgestreckt hat und herum kriecht. Zieht sie sich in ihr Gehäuse zurück, schwingt das Clausilium jedoch dank seines elastischen Stiels nach außen, so dass es die Gehäusemündung verschließt.
H. Nordsieck hat 1982 nachweisen können, dass das Clausilium (Bild rechts)
sich vermutlich im Tertiär aus einer der Spindellamellen (Lamella columellaris
![]() )
eines Vorfahren der heutigen Schließmundschnecken entwickelt hat, da diese
Lamelle bei den fossilen Arten noch vorhanden ist, bei den heutigen
Schließmundschnecken aber fehlt, wohingegen diese ein Clausilium besitzen und
die fossilen Arten nicht.
)
eines Vorfahren der heutigen Schließmundschnecken entwickelt hat, da diese
Lamelle bei den fossilen Arten noch vorhanden ist, bei den heutigen
Schließmundschnecken aber fehlt, wohingegen diese ein Clausilium besitzen und
die fossilen Arten nicht.
![]() Nordsieck,
H. (1982): Die Evolution des Verschlußapparats der Schließmundschnecken
(Gastropoda: Clausiliidae). Arch. Moll. I 112 (1981) I (1/6) I 27—43. (Link).
Nordsieck,
H. (1982): Die Evolution des Verschlußapparats der Schließmundschnecken
(Gastropoda: Clausiliidae). Arch. Moll. I 112 (1981) I (1/6) I 27—43. (Link).
Die Bedeutung des Clausiliars für die Evolution der Schließmundschnecken ist nicht völlig geklärt. Bereits H. Nordsieck (1982) ging aber schon mit einiger Sicherheit davon aus, dass es sich um einen weiteren Schutz gegen Trockenheit handelt, besonders angesichts ihres Verbreitungsschwerpunktes auf dem Balkan und in Kleinasien.
![]() Hartmut Nordsieck:
hnords.de:
Sammeln und
Bearbeitung
von Schließmundschnecken.
Hartmut Nordsieck:
hnords.de:
Sammeln und
Bearbeitung
von Schließmundschnecken.
Wissenschaftlich sind die Schließmundschnecken besonders deswegen von großem Interesse, weil sie auf vergleichsweise engem Raum in großer Artenzahl vorkommen. Populationen kommen manchmal nur an einem einzigen Felsen vor und sind durch sonnenexponierte Gebiete isoliert, so dass es isolationsbedingt zur allopatrischen Artbildung kommen kann. Andererseits kann es bei nahe verwandten Arten zur Hybridisierung und so zur sympatrischen Artbildung kommen. Diese konnte von H. Nordsieck und anderen in zahlreichen Clausiliengruppen nachgewiesen werden (vgl.: H. Nordsieck (2022): European Door Snails (Clausiliidae) I, Kap. 8, S. 156 ff.). Gerade dann reichen Schalenmerkmale und Form des Schließapparates als Bestimmungsmerkmale nicht aus, stattdessen ist eine anatomische Untersuchung des Genitalapparats notwendig.
![]() Hartmut Nordsieck:
hnords.de:
Hybridization in European Clausiliidae.
Hartmut Nordsieck:
hnords.de:
Hybridization in European Clausiliidae.
Angesichts der teilweise sehr kleinräumigen Verbreitung einzelner Arten von Schließmundschnecken kann der menschliche Einfluss sehr große Bedeutung gewinnen, da ähnlich, wie bei Inselpopulationen endemischer Schneckenarten durch Straßenbau, Landwirtschaft und Beeinträchtigung der Umwelt sehr schnell großer und irreversibler Schaden angerichtet werden kann. Ein Beispiel dafür ist die Gedrungene Schließmundschnecke (Pseudofusulus varians), die in Teilen ihres Verbreitungsgebietes (die Art kommt in den Ostalpen und in den nordwestlichen Karpaten vor) bereits ausgestorben ist oder stark reduziert vorkommt. Pseudofusulus varians lebt nur in naturbelassenen und vom Menschen unbeeinflussten Laubwäldern mit großem Totholzanteil. Durch Totholzräumung und Ausholzung werden die Lebensräume der Schnecke zerstört und ganze Populationen verschwinden.
![]() Gedrungene Schließmundschnecke
(Pseudofusulus varians).
Gedrungene Schließmundschnecke
(Pseudofusulus varians).
Gemeine Schließmundschnecke -
Alinda
biplicata (Montagu, 1803).
 Gemeine Schließmundschnecke (Alinda biplicata). Bild: Sigrid Hof (Quelle). |
 Gemeine Schließmundschnecke (Alinda biplica- ta) mit Schüsselschnecke (Discus rotundatus). Bild: Martina Eleveld. |
Beschreibung: Das Gehäuse der Gemeinen Schließmundschnecke ist hellbraun und
relativ groß. Die Gehäuseoberfläche weist deutlich erkennbare Rippen auf, die an
der Windungsnaht weißlich betont sind. Die Dichte der Rippen liegt auf der
vorletzten Gehäusewindung bei 5 - 6 Rippen pro Millimeter. Die etwas erweiterte
Mündungslippe weist keine Fältchen auf und die Mündung ist unten etwas
zugespitzt, mit einer ausgeprägten Basalrinne. Die Unterlamelle ist einfach,
eine obere Parietallamelle ist bei senkrechtem Mündungseinblick deutlich
sichtbar.
![]() .
.
Maße: H: 16 - 18 (- 22) mm; B: 3,8 - 4 mm.
![]()
Lebensraum und Verbreitung: Die Gemeine Schließmundschnecke lebt bevorzugt an schattigen, eher feuchten Standorten in Wäldern in der Laubschicht und an Totholz, in Krautbüscheln (z.B. Brennesseln), zwischen Felsen und an alten Mauern. Die Schnecke ist vor allem bodenbewohnend, steigt allerdings bei feuchtem Wetter auch manchmal an Bäumen empor. In Kulturgebieten ist sie auch oft zu finden, gehört also zu den Schließmundschnecken, die relativ wahrscheinlich auch einmal im Garten zu finden sind, vor allem, wenn es dort auch eine Mauer gibt. Zwergwüchsige Formen von Alinda biplicata sind auch an warm-trockenen (xerothermen) Standorten zu finden. Die Art bevorzugt vor allem Biotope mit kalkhaltigem Boden.
Alinda biplicata ist im Allgemeinen ovovivipar, bringt also lebende Jungtiere zur Welt, die zuvor im Muttertier geschlüpft sind, unter günstigen Umweltbedingungen kann sie aber auch bis zu 11 Eier legen.
Das Verbreitungsgebiet der Gemeinen Schließmundschnecke umfasst weite Teile Mitteleuropas, von Nordfrankreich, Belgien und den Niederlanden über Deutschland, die Schweiz, Österreich, Tschechien und die Slowakei bis nach Ungarn, West und Südpolen, im Südosten bis nach Bulgarien. In Südengland kommt die Art im Tal der Themse und in Ost-Cornwall vor und hat sich auch erfolreich in Gärten angesiedelt. Dort ist sie offenbar heimisch, da auch Fossilien aus dem Holozön bekannt sind. Die Lebensräume sind jedoch durch Gewässerrandbebauung bedroht, bzw. zu großem Teil zerstört. An isolierten Standorten kommt die Art auch in Dänemark, Südschweden und Südnorwegen vor. Dies ist möglicherweise auf eine Verschleppung durch den Menschen zurück zu führen.
In der Schweiz kann die Gemeine Schließmundschnecke bis in einer Höhe von 800 m auftreten, in Österreich und Bulgarien bis in einer Höhe von 2300 m.
Bosnische Schließmundschnecke - Herilla bosniensis (Vest, 1867)
 Bosnische Schließmundschnecken (Herilla bosniensis) in ihrem natürlichen Lebensraum in der Klausen in Mödling. Bild: © Alexander Mrkvicka, Wien. |
 Blick in die Klausen in Mödling (Niederösterreich). Bild: Martina Eleveld. |
![]() Bosnische
Schließmundschnecke (Herilla bosniensis).
Bosnische
Schließmundschnecke (Herilla bosniensis).
Italienische Schließmundschnecke - Papillifera papillaris (O.F. Müller, 1774)
 Italienische Schließmundschnecken (Papillifera bidens), zwei Exemplare paaren sich. Bild: Sigrid Hof (Quelle). |
Ein weiteres Vorkommen der Art war bereits seit 1993 von der kleinen Insel Brownsea Island in Dorset an der Südküste Englands nahe Bournemouth bekannt und bestimmt worden. Diese Population war zwar offensichtlich in den 1880er Jahren mit Felsen aus Griechenland eingeschleppt worden, gehöre jedoch offenbar zur selben Art.
Zu Beginn waren die in England gefundenen Schließmundschnecken als Papillifera bidens (Linnaeus, 1758) bestimmt worden. Während man in Großbritannien nach weiteren Populationen der Art suchte (die zum Glück nahezu unverwechselbar ist), war jedoch unter den Gelehrten eine teilweise hitzige Diskussion entbrannt, wie die Art eigentlich korrekt heißen müsse.
Der ursprüngliche Name Papillifera papillaris fiel zunächst einem älteren Namen, Papillifera bidens (Linnaeus, 1758) zum Opfer, wie auch die ICZN in einer Opinion 2007 veröffentlicht hatte. Andererseits vertritt eine Veröffentlichung von Kadolsky (2009) die Meinung, dass auch dieser Name nicht korrekt sei, da Linné ursprünglich eine andere Art, heute Cochlodina incisa, beschrieben habe. Diese ähnelt Papillifera bidens jedoch bestenfalls entfernt (beides sind Schließmundschnecken), daher vertrat z.B. H. Nordsieck die Meinung, dass Kadolskys Schlussfolgerungen unhaltbar und der wissenschaftliche Name Papillifera bidens absolut korrekt sei.
Schlussendlich wurden die in Großbritannien aufgefundenen Schließmundschnecken doch der Art Papilifera papillaris zugeordnet und der Artname bidens wurde andererseits für eine Cochlodina-Art aus Italien verwendet, die vorher Clausilia (oder Cochlodina) incisa geheißen hatte und seither als Cochlodina bidens (Linnaeus, 1758) (s.u.) bezeichnet wird.

Die Homepage von Hartmut Nordsieck über
Helicoidea, Cochlostoma und Clausiliidae auf hnords.de.
Letzte Änderung: 16.09.2025 (Robert Nordsieck).