| This page in English! |
Die Gemeine MiesmuschelMytilus edulis Linnaeus, 1758 |
 Miesmuschelbank in Zeeland, Niederlande. Bild: Maaike Verschueren (iNaturalist). |
Klasse: Bivalvia
![]() Unterklasse: Autobranchia
Unterklasse: Autobranchia
![]()
![]() Infraklasse: Pteriomorphia
Infraklasse: Pteriomorphia
![]()
![]() Ordnung: Mytilida
Ordnung: Mytilida
![]()
![]() Überfamilie: Mytiloidea
Überfamilie: Mytiloidea
![]()
![]() Familie: Mytilidae
Familie: Mytilidae
![]()
![]() Mytilus edulis Linnaeus, 1758
Mytilus edulis Linnaeus, 1758
Quelle: MolluscaBase eds. (2025): Mytilus edulis Linnaeus, 1758.
 Miesmuscheln mit Seepocken. Bild: Keith Hiscock, Marine Life Network. |
 Einströmöffnung (links) und Ausströmöffnung (Mitte) einer lebenden Miesmuschel. Rechts im Bild der Fuß der Muschel. Quelle: Tiere der Ostsee: Die Miesmuschel. |
Vom Weichkörper der Muschel sieht man außerhalb der Schale meist nur den kräftigen Fuß, an dessen Ende sich die Byssus-Drüse befindet. Diese produziert den Byssus-Faden, einen widerstandsfähigen Faden auf Eiweißbasis, ein Teil des Erfolges der Miesmuschel. Mit den Byssus-Fäden können sich Miesmuscheln nämlich nicht nur am Untergrund, sowie an anderen Muscheln befestigen, sondern sie können sich unter Zuhilfenahme der Byssus-Fäden auch fortbewegen, indem sie einen Byssus-Faden auslegen und ihn anschließend verkürzen, worauf sich die Muschel bewegt.
Außer dem Fuß kann man die beiden Siphos erkennen, wenn die Muschel ihre Schalenklappen weit genug geöffnet hat. Das tun Miesmuscheln nur unter Wasser, um zu atmen und sich zu ernähren.
Experiment mit Miesmuscheln Hafenwasser in Juist wird in zwei Gläser abgefüllt. In das Glas rechts werden eine Handvoll Miesmuscheln gesetzt. Das Wasser im linken Glas dient zum Vergleich. |
|
 Nach einer Stunde. Die Miesmuscheln im rechten Glas ha- ben das Wasser so weit geklärt, dass man hindurch sehen kann. Quelle: Aldebaran (1997). |
Was geschieht nun aber mit den Schwebstoffen, die von der Miesmuschel aus dem Seewasser gefiltert werden? Aus dem Atemwasser filtert die Muschel verdauliche Partikel heraus und führt sie dem Verdauungstrakt zu. Unverdauliche Partikel werden über den ausführenden Sipho wieder ausgestoßen. Um sich herum sammelt die Muschel daher eine Menge Schlick an, der aus vormals im Seewasser schwebenden Teilchen besteht.
Die Gemeine Miesmuschel (Mytilus edulis) war ursprünglich wohl auf die Küstengewässer des östlichen Nordatlantiks von etwa der Aquitaine bis Nordnorwegen, das Weiße Meer und Spitzbergen beschränkt. Im westlichen Nordatlantik kommt sie von Washington D.C. bis etwa Maine vor. Ab Nova Scotia nordwärts wird sie durch die Pazifische Miesmuschel (Mytilus trossulus) ersetzt. In Südgrönland und Island konnte die Gemeine Miesmuschel hingegen nachgewiesen werden. Sie kommt heute durch Verschleppung und gezielte Ansiedlung in Aquakulturen auch im Nordpazifik vor. Im Mittelmeer kommt stattdessen die Mittelmeer-Miesmuschel (Mytilus galloprovincialis) vor. Nachdem die einzelnen Mytilus-Arten sehr nahe verwandt sind und auch untereinander hybridisieren können, spricht man auch vom Mytilus edulis-Komplex.
Typische Lebensräume befinden sich von der Hochwasserlinie abwärts vor Felsküsten bis in die Nähe von Flussmündungen, wobei die Muscheln oft gemeinsam mit Seepocken dichte Bänke bilden.
Auch in der Ostsee sind Miesmuscheln anzutreffen, erreichen dort aufgrund des geringeren Salzgehaltes jedoch nur eine vergleichsweise kleine Größe von bis zu fünf Zentimetern, während ihre Verwandten in der Nordsee bis zu doppelt so groß werden können und stabilere Schalen ausbilden.
Ihr bevorzugter Lebensraum befindet sich im Gezeitenbereich und flachen Wasser, bis zu einer Wassertiefe von etwa 20 Metern, wo sie sich mit ihren Byssusfäden an feste Untergründe heftet. Die Fäden produziert die Muschel mit einer am Fuß befindlichen Drüse. Durch die Anheftung schützt sich das Schalenweichtier gegen Verdriftung und ist in der Lage, sich aus dem Schlamm herausziehen, der sich durch ihre eigene Filtertätigkeit in ihrer direkten Umgebung ansammelt. Die Muschel kann ihre Anheftung selbst lösen und sich, mithilfe des Fußes, ein Stück bewegen, um sich an anderer Stelle wieder anzuheften. Sie braucht im Sommer Wassertemperaturen von mindestens 4 °C. In Muschelbänken können sie sehr dichte Bestände von bis zu 2.000 Tieren pro Quadratmeter bilden.
Ähnlich wie ihre Ernährung ist auch die Vermehrung der Miesmuschel vom umgebenden Wasser abhängig. Miesmuscheln sind getrennt geschlechtlich, d.h. es gibt Männchen und Weibchen. Im Frühjahr und mehrmals im Sommer gibt jedes Miesmuschelweibchen etwa 5 bis 12 Millionen Eier ins Wasser ab, wo die Befruchtung durch Samenzellen durch Männchen der Umgebung statt findet. Das ergibt eine Konzentration von einer Muschellarve pro Milliliter Meerwasser!
 Veliger-Larve von M. galloprovincialis. Quelle: Universität Ferrara, Italien. |
Bis sie etwa 5 cm groß sind, können die Jungmuscheln jedoch noch mehrfach den Standort wechseln. Dann setzen sie sich endgültig an einem geeigneten Untergrund fest, bevorzugt in der Nähe anderer Muscheln. Durch Millionen an ihren Byssus-Fäden aneinander hängende Miesmuscheln entstehen die bekannten Miesmuschelbänke. Der Vorteil für die Muscheln ist nahe liegend: Wenn sie in Ansammlungen zusammenleben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass von einem Männchen ausgestoßene Samenzellen auf Eizellen einer anderen Miesmuschel treffen und diese befruchten können, am höchsten.
Selbst nach ihrer Ansiedlung sind Miesmuscheln vielen Feinden aus dem Wasser und aus der Luft ausgesetzt. Über Wasser sind Möwen und Austernfischer, unter Wasser Eiderenten, Seesterne und Krebse die Feinde der Miesmuschel.
Ein großer Miesmuschelräuber ist auch die Wellhornschnecke (Buccinum undatum). Diese größte Raubschnecke der Nordsee lauert vor einer Miesmuschel und wartet, bis diese die Schalenhälften öffnen muss, um zu atmen. Dann schiebt sie Sipho und Schnauze zwischen die Schalenhälften und beginnt, die nunmehr wehrlose Muschel aufzufressen.
 Netzreusenschnecke (Hinia reticulata). Bild: Eric Walravens. |
Neben diesen biotischen Faktoren sind auch abiotische Faktoren von großer Bedeutung für das Leben und Überleben der Miesmuscheln. Muschelbänke, die trocken fallen, können im Winter durch Eisschollen abgehobelt und zerstört werden. Andererseits sind die trocken fallenden Miesmuschelbänke (durch die Ansammlung von Schlick durch die Filtration der Muscheln werden die Muschelbänke langsam über den Meeresspiegel angehoben) nicht der Nachstellung unter Wasser jagender Räuber, wie der Wellhornschnecke und den Seesternen, ausgesetzt. Für Miesmuscheln am günstigsten hat sich eine Lage gerade knapp über der Niederwasserlinie erwiesen. Diese Muschelbänke liegen pro Tide etwa 4 Stunden trocken; genug, um Seesterne und Schnecken zum Rückzug zu zwingen.
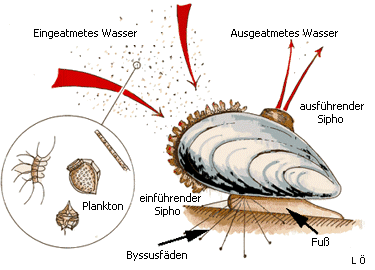 Atmung und Ernährung bei der Miesmuschel (Mytilus edulis). Quelle: Aquascope. |
Der wissenschaftliche Name Mytilus geht auf den griechischen Philosophen Aristoteles zurück. "Μυτίλος" (mytilos) bezeichnete schon im antiken Griechenland eine essbare Muschel. Der lateinische Zusatz edulis bekräftigt noch mal die Tatsache, dass Miesmuscheln essbar und darüber hinaus sehr schmackhaft sind. Die Muschelfischerei findet an der deutschen Küste in Niedersachsen und Schleswig-Holstein bereits seit über 100 Jahren statt. Neben der herkömmlichen Abfischung natürlicher Muschelbänke (die inzwischen recht selten geworden sind), werden seit den 30er Jahren künstliche Muschelbänke in geschützter Lage geschaffen. Diese Muschelkulturen werden weniger stark von Räubern heimgesucht und entwickeln daher größere Muscheln, die frühestens nach einem Jahr reif für den Verkauf sind.
Marktführend in der Muschelkultur sind in Europa die Niederlande und Dänemark mit ca.
100.000 t Miesmuscheln pro Jahr, im Vergleich zu 20.000 t aus Schleswig-Holstein
und 8.000 t aus Niedersachsen.
Letzte Änderung: 05.11.2025 (Robert Nordsieck).